-
Hinweise zu den Bildquellen
Die verwendeten Bilder stammen entweder pixabay.com - sie unterliegen der Pixabay Lizenz (Free for commercial use | No attribution required) oder es handelt sich um eigene Abbildungen.
Hinweise zum DatenschutzDieses Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte QUA-LiS NRW keinen Einfluss hat. Dementsprechend obliegt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen dem jeweiligen Anbieter bzw. Betreiber. Im Sinne der gesetzlichen Gesamtverantwortung für den Datenschutz an Schulen prüfen Schulleitungen daher vor einem Einsatz der genannten Quellen eigenverantwortlich, inwieweit und unter welchen Bedingungen die Nutzung der genannten Quellen für den beabsichtigten Zweck datenschutzrechtskonform möglich ist. Ggf. resultiert aus einer solchen Prüfung im konkreten Fall, dass die allgemeine Nutzung weitestgehend nur auf freiwilliger Basis möglich ist, d.h. Schülerinnen und Schüler (oder deren Erziehungsberechtige) bzw. Lehrerinnen und Lehrer nicht oder nur eingeschränkt zur Nutzung verpflichtet werden können. Die innerhalb dieses Kurses getroffene Auswahl an externen Anwendungen sind exemplarisch zu betrachten. Es werden zahlreiche Anwendungen mit ähnlicher Funktionalität angeboten.
SicherungdateiDie Sicherungsdatei zum Kurs finden Sie hier zum Download (123.7 MB). Mit Hilfe dieser Datei kann der Kurs im LOGINEO NRW LMS der eigenen Schule wiederhergestellt und weiter bearbeitet werden.
Hinweis: Um die Inhalte des Glossars mit zu überführen, muss bei der Wiederherstellung der Sicherungsdatei der Haken bei "Eingeschriebene Nutzer/innen einbeziehen" gesetzt werden.
-
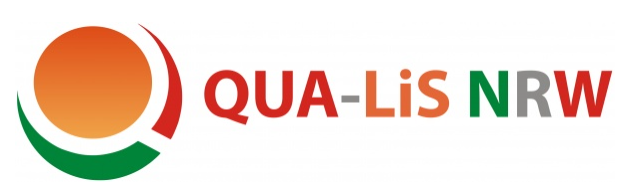
-
 Worum geht es in diesem Kurs?
Worum geht es in diesem Kurs?Im vorliegenden Kurs werden Überlegungen dargestellt, wie eine Leistung im Rahmen einer kompetenzorientierten Lern- und Prüfungskultur erfasst werden kann.
Diese Überlegungen wurden auf der Grundlage der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben (KLP und APO SI) angestellt.
Wie können Lehrkräfte mit diesem Kurs arbeiten?Dieser Kurs steht zur Ansicht in der Demo-Version zur Verfügung. Zudem wird eine Sicherungsdatei im Bereich "Hilfe" angeboten. Mit Hilfe dieser Sicherungsdatei ist es möglich, diesen Kurs im eigenen LMS wiederherzustellen und z.B. im Rahmen von Fachschaftsarbeiten zu adaptieren.
Wie ist dieser Kurs aufgebaut?Die Ausführungen in diesem Kurs bedienen unterschiedliche Ebenen:
Übergreifende Überlegungen hinsichtlich "Zeitgemäßer Prüfungskultur" in Form einer FAQ-Liste im Bereich "Allgemeine Informationen".
Anregungen in den Kacheln hinsichtlich
- zeitgemäßer Lernkultur - Wie können zeitgemäße Lern- und Leistungsaufgaben konstruiert werden?
- Performanzsituationen - Welche Möglichkeiten stehen Lernenden offen, Kompetenzerwerb darzustellen?
- Feedback - Welche Möglichkeiten des formativen und summativen Assessments sind möglich?
- Leistungsbewertung - Wie kann der Kompetenzerwerb ermittelt und bewertet werden?
Die aufgezeigten Anregungen und Hinweise werden im Rahmen exemplarisch konkretisierter Unterrichtsvorhaben für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik umgesetzt.
Im Hilfe-Bereich sind ergänzende Angebote (u.a. Glossar zur Begriffsklärung) zum Kurs zu finden.
Welche Bezüge können zur Legitimation exemplarisch hergestellt werden?Curriculare Vorgaben
„Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers sein.“ (§48 Abs.1 SchulG)
„Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ (§48 Abs. 2 SchulG)
„Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen.“ (§6 Abs. 2 APO SI)
Bezug zum Impulspapier II
„Feedback und Partizipation als Lernprozesselemente: Formatives Feedback durch die Lehrkräfte sowie Feedback durch die Mitschülerinnen und Mitschüler und Lernpartnerinnen und -partner sind fester Bestandteil des Unterrichts bzw. schulischer Lehr-/ Lernprozesse in der digitalen Welt. Dazu werden Schülerinnen und Schüler – wo möglich und sinnvoll – auch in die Gestaltung des Unterrichts bzw. der Lehr-/Lernprozesse aktiv eingebunden.“ (Impulspapier II, S. 10)
„Erprobung und Weiterentwicklung von Formen der Leistungsüberprüfung: Die bereits jetzt mögliche Vielfalt der Formen der Leistungsüberprüfung wird mit Blick auf die erweiterten Möglichkeiten des Lernens in der Kultur der Digitalität im Hinblick auf eine lernförderliche und zeitgemäße Aufgabenkultur sukzessive weiterentwickelt. Die durch Leistungsüberprüfungen erhobenen Lernstände werden in den Lernprozess zurückgeführt. Dazu werden neue Wege reflektiert erprobt und ggf. entsprechende Vereinbarungen fortgeschrieben.“ (Impulspapier II, S. 10)
Bezug zur Ergänzenden Empfehlung der KMK
„Zur Förderung und zur Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens in der digitalen Welt bedarf es neben der grundsätzlichen Veränderung und Erweiterung von Lernangeboten auch der Entwicklung einer neuen Aufgaben- und Prüfungskultur. Hierbei gilt es, die interdependente Verknüpfung von Lernzielen und zu erwerbenden Kompetenzen, von Lehr-Lern-Methoden und Aufgabenkultur sowie der Prüfungskultur zu berücksichtigen.“ (Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, S. 9)
„Zukünftige Prüfungsformate beziehen daher auch verstärkt Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und Kommunikation mit ein.“ (Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, S. 15)
„In mündlichen Prüfungsformaten können in einer Kultur der Digitalität unter Nutzung digitaler Möglichkeiten die kommunikativen Anteile des Lernens und Verstehens umfangreicher als bisher einbezogen werden. Hierdurch würde von Beginn der Schullaufbahn an altersgerecht ein Fokus auf die Fähigkeit gelegt, sich Wissensbeständen diskursiv zu nähern, um Reflexionsprozesse und das gemeinsame Weiterentwickeln von Positionen in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht zuletzt wird damit auch ein Beitrag zur Weiterentwicklung demokratischer Grundwerte geleistet.“ (Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, S. 16)
„Insgesamt erscheint es für das Lehren und Lernen in der digitalen Welt notwendig, bestehende Prüfungsformate kritisch zu untersuchen und weiterzuentwickeln sowie Prüfungsformate zu etablieren, die die Kompetenzen in der digitalen Welt angemessen überprüfen, die die erweiterten digitalen Möglichkeiten nutzen, stärker metakognitive Fähigkeiten in den Prüfungen verlangen und Reflexionsleistungen einbeziehen.“ (Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, S. 16)
Bezug zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Fachliche und überfachliche Kompetenzen: Kriterium 1.1.1
„Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die dargelegten fachlichen Kompetenzen, die in den Bildungsstandards, Lehrplänen, Bildungsplänen, Richtlinien und weiteren Vorgaben ausgewiesen sind.“
Fachliche und überfachliche Kompetenzen: Kriterium 1.1.2
„Die Schülerinnen und Schüler verfügen über überfachliche Kompetenzen, wie sie in Schulgesetz, Richtlinien, weiteren Vorgaben zu pädagogischen und gesellschaftlich bedeutenden Aufgabenbereichen und KMK-Vereinbarungen aufgeführt sind.“
Langfristige Wirkungen: Kriterium 1.4.2
„Die von den Schülerinnen und Schülern erworbenen Kompetenzen ermöglichen ihnen weiteres erfolgreiches Lernen.“
Kompetenzorientierung: Kriterium 2.2.1
„Die individuelle Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler steht im Zentrum der Planung und Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse.“
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung: Kriterium 2.7.2
„Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind.“
Bezug zum Orientierungsrahmen "Lehrkräfte in der digitalisierten Welt"
Unterrichten: Veränderung der Lernkultur
Lernkultur teamorientiert, kooperativ und kollaborativ unter Nutzung erweiterter pädagogischer Ansätze und technologischer Möglichkeiten gestalten und personalisiertes und selbstbestimmtes Lernen unterstützen
„Bei allen angeführten unterrichtsbezogenen Kompetenzen geht es nicht um die Digitalisierung des Analogen, sondern vielmehr um die Entwicklung einer zukunftsweisenden Lernkultur unter Berücksichtigung aktueller mediendidaktischer und lehr- und lernpsychologischer Erkenntnisse, die u.a. auf kooperatives und kollaboratives Lernen sowie auf eine kreative und eigenaktive Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler setzt und personalisiertes, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Lernen unterstützt.“ ( Lehrkräfte in der digitalisierten Welt, S. 16)
Lernen und Leisten fördern: Aufgaben- und Prüfungsformate
Neue, auch adaptive technologiebasierte Aufgaben- und Prüfungsformate kennen, einsetzen und selbstständig entwickeln
„Dabei gilt es, Lehr- und Lernprozesse und das schulische Umfeld so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler von den Chancen digitaler Medien im Sinne eines fachlichen und überfachlichen Kompetenzerwerbs und im Hinblick auf lebenslanges Lernen profitieren.“ (Lehrkräfte in der digitalisierten Welt, S. 20)
Beraten: Lernberatung
Möglichkeiten lernprozessbegleitenden und summativen Feedbacks mithilfe digitaler Medien kennen und gezielt für die Lernberatung einsetzen
„Durch die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen ergeben sich im schulischen Kontext neben neuen Beratungsanlässen auch neue Beratungsmöglichkeiten. Diese umfassen einerseits lernprozessbegleitendes und summatives Feedback, das mithilfe digitaler Möglichkeiten mit dem Ziel der Lernberatung und -förderung bereitgestellt und für das weitere Lernen genutzt werden kann.“ (Lehrkräfte in der digitalisierten Welt, S. 23)
-
Im vorliegenden Kurs erhalten einzelne Lehrkräfte und Fachkonferenzen im Fachbereich Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe I (schulformübergreifend) Anregungen für eine zeitgemäße Lern- und Prüfungskultur. Diese Anregungen sind als erste Impulse zu verstehen, die u.a. bei der Weiterentwicklung des Fachunterrichts zum Tragen kommen und erweitert werden können. Viele Impulse sind zudem geeignet, auf andere Fächergruppen übertragen zu werden. Exemplarische fachbezogene Unterrichtsbeispiele finden Sie unter „Konkretisierungen am Beispiel der Gesellschaftslehre“. Grundsätzliche Überlegungen zur „zeitgemäßen Prüfungskultur" finden Sie unter „Allgemeine Informationen“.
Die Überlegungen wurden vollständig vor dem Hintergrund aktuell gültiger rechtlicher Vorgaben (Stand: August 2023) angestellt, sodass eine rechtssichere Verwendung der Impulse und Materialien gegeben ist. Die Möglichkeiten der Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz (KI) wurden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt, da diesbezüglich noch zu viel Klärungsbedarf besteht. Erste Information und Orientierung zu KI-Anwendungen bieten der „Handlungsleitfaden zum Umgang mit textgenerierenden Systemen“ sowie der ergänzende LOGINEO NRW LMS - Kurs.
-
Allgemeine InformationenKonkretisierungen am Beispiel der Gesellschaftslehre
- Impulse für eine zeitgemäße Fachkonferenzarbeit - Möglicher Leitfaden
Mit Hilfe einer TaskCards-Zeitleiste wird ein möglicher Leitfaden dargestellt, wie der vorliegende LOGINEO NRW LMS - Kurs im Rahmen von Fachkonferenzarbeit zum Tragen kommen kann. Dieser Leitfaden ist exemplarisch angelegt, um die Verweise zum vorliegenden Kurs ersichtlich zu machen und kann geeignet sein, etablierte Strukturen der jeweiligen Fachkonferenzarbeit zu bereichern. - Politik: Impulse für eine zeitgemäße Fachkonferenzarbeit - Weiterentwicklung eines konkreten Unterrichtsvorhabens „Ohne Smartphone bist du raus? Leben in der digitalisierten Welt”
Auf der Grundlage des vorgestellten Leitfadens wird exemplarisch veranschaulicht, wie die TaskCards-Zeitleiste adaptiert werden kann, um eine gemeinsame Transformation eines konkreten Unterrichtsvorhabens unter Einsatz eines zeitgemäßen Prüfungsformates in der Fachkonferenz Politik (Realschule) zu dokumentieren. Das gewählte Unterrichtsvorhaben ist in modifizierter Form auch zum Einsatz in den anderen Schulformen geeignet. - Erdkunde: Impulse für eine zeitgemäße Fachkonferenzarbeit - Weiterentwicklung eines konkreten Unterrichtsvorhabens „Ohne Landwirtschaft vor Ort geht es nicht? – Lebensmittelproduktion bei uns”
Auf der Grundlage des vorgestellten Leitfadens wird exemplarisch veranschaulicht, wie die TaskCards-Zeitleiste adaptiert werden kann, um eine gemeinsame Transformation eines konkreten Unterrichtsvorhabens unter Einsatz eines zeitgemäßen Prüfungsformates in der Fachkonferenz Erdkunde (Hauptschule) zu dokumentieren. Das gewählte Unterrichtsvorhaben ist in modifizierter Form auch zum Einsatz in den anderen Schulformen geeignet. - Geschichte: Impulse für eine zeitgemäße Fachkonferenzarbeit - Weiterentwicklung des konkreten Unterrichtsvorhabens „Die Welt im Kalten Krieg und das geteilte Deutschland”
Auf der Grundlage des vorgestellten Leitfadens wird exemplarisch veranschaulicht, wie die TaskCards-Zeitleiste adaptiert werden kann, um eine gemeinsame Transformation eines konkreten Unterrichtsvorhabens unter Einsatz eines zeitgemäßen Prüfungsformates in der Fachkonferenz Geschichte (Gesamtschule) zu dokumentieren. Das gewählte Unterrichtsvorhaben ist in modifizierter Form auch zum Einsatz in den anderen Schulformen geeignet.
Hilfe und KontaktErklärvideo zu exemplarischen Einsatzmöglichkeiten des Visualisierungsnetzes
Tutorial zur Handhabung des Visualisierungsnetzes
Kontakt
Bei Fragen oder Rückmeldungen zu diesem Angebot kontaktieren Sie bitte
Stephanie Holberg, Referentin für Distanzunterricht / Lehren und Lernen mit digitalen Medien
stephanie.holberg@qua-lis.nrw.de
Telefon: 02921 - 683 4012Aktualität
Dieser Kurs wurde im August 2023 fertiggestellt und ist danach nicht mehr aktualisiert worden. Webangebote und Links können sich verändern oder nicht mehr verfügbar sein. Wir bitten daher um Nachsicht, falls ein genanntes und/oder verlinktes Angebot nicht mehr erreichbar ist oder sich verändert hat.
Lizenzen
Dieses Angebot und dessen Inhalte sind - sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC-BY-SA 4.0.
Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „Zeitgemäße Prüfungskultur - Unterstützungsangebot für eine zeitgemäße Unterrichtsentwicklung“ produziert von der QUA-LiS NRW zur Veröffentlichung auf https://402000.logineonrw-lms.de/. Lizenz: CC BY-SA 4.0.
Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
Die im Kurs verwendeten Abbildungen sind - sofern nicht im oder am jeweiligen Element anders angegeben - stammen von Pixabay und stehen unter freier Lizenz (CC0).
Glossar
- Impulse für eine zeitgemäße Fachkonferenzarbeit - Möglicher Leitfaden
Zeitgemäße Prüfungskultur
Diese Aktivität ist im Moment nicht verfügbar.



