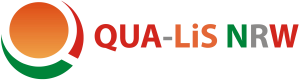Allgemeine Hinweise zum Unterrichtsvorhaben
Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen - Geschichte (PDF, 260 KB)
Inhaltsfeld:
- Inhaltsfeld 8: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
Das Inhaltsfeld geht von den historischen Bedingungen, Ausprägungen und Auswirkungen der NS-Herrschaft aus. Die Auseinandersetzung mit Erfahrungen von Zerschlagung demokratischer Institutionen und Errichtung totalitärer Herrschaft, von Krieg und organisiertem Massenmord ist ebenso Gegenstand des Inhaltsfeldes wie die begründete Reflexion des eigenen Humanitäts- und Demokratieverständnisses. Welche globale Dimension und Kohärenz der Zweite Weltkrieg hatte, zeigen der Kriegseintritt der USA nach Pearl Harbor und die Kriegserklärung an die USA durch NS-Deutschland. Für die Behandlung des Inhaltsfeldes gilt in besonderer Weise, die auf Basis der westlichen, aufgeklärten Tradition errungenen Menschen- und Bürgerrechte in ihrer universellen Gültigkeit zu verorten.
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Ende des Rechts- und Verfassungsstaats (1933/34)
- Der Nationalsozialismus – Ideologie und Herrschaftssystem
- Alltagsleben in der NS-Diktatur zwischen Zustimmung, Unterdrückung, Verfolgung, Entrechtung und Widerstand
- 2. Weltkrieg, Vernichtungskrieg und Holocaust
- Flucht und Vertreibung im europäischen Kontext
Kompetenzerwartungen (Schwerpunkte hervorgehoben):
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler- erläutern Interessen und Handlungsspielräume historischer Akteurinnen und Akteure in den jeweiligen Gesellschaften (SK 4),
- stellen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Prozessen in der Geschichte dar (SK 8).
Konkretisierte Sachkompetenz:
- erläutern Merkmale des totalen Staates und Stufen seiner Verwirklichung im Nationalsozialismus,
- erläutern grundlegende Elemente der NS-Ideologie (u.a. „Rassenlehre“, Antisemitismus, „Führergedanke“), deren Ursprünge und deren gesellschaftliche und politische Auswirkungen,
- erläutern Maßnahmen, deren Zielsetzungen und ihre Auswirkungen auf Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Andersdenkende, Euthanasieopfer und Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter von Seiten des NS-Staates,
- stellen Verbrechen an der Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkrieges dar.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
- recherchieren in Geschichtsbüchern, digitalen Medienangeboten sowie ihrem schulischen und außerschulischen Umfeld und beschaffen zielgerichtet Informationen und Daten zu historischen Problemstellungen (MK 2),
- wenden zielgerichtet Schritte der Analyse und kritischen Auseinandersetzung mit auch digitalen historischen Darstellungen fachgerecht an (MK 5).
Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
- bewerten unter Offenlegung der eigenen Wertmaßstäbe und gegenwärtiger Normen menschliches Handeln in der Vergangenheit im Kontext eines Falles oder Beispiels mit Entscheidungscharakter (UK 4),
- überprüfen anhand von bekannten Kriterien, ob ihre Informationen zur Beantwortung einer Urteilsfrage ausreichend sind (UK 6).
Konkretisierte Urteilskompetenz:
- erörtern an Beispielen Handlungsspielräume der Menschen unter den Bedingungen der NS-Diktatur,
- erörtern die sich aus der nationalsozialistischen Vergangenheit ergebende historische Verantwortung im Umgang mit der eigenen Geschichte.
Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
- reflektieren im Rahmen des Vergleichs mit früheren Wertvorstellungen die eigenen Deutungsmuster und Wertmaßstäbe (HK 3).
Querschnittsthemen:
„Im Rahmen des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule unterstützt der Unterricht im Fach Geschichte die Entwicklung einer mündigen und sozial verantwortlichen Persönlichkeit und leistet weitere Beiträge zu fachübergreifenden Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht, hierzu zählen u.a. Menschenrechtsbildung, Werteerziehung, politische Bildung und Demokratieerziehung, Bildung für die digitale Welt und Medienbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, geschlechtersensible Bildung, kulturelle und interkulturelle Bildung.” (Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen Geschichte, S. 10)
Innerhalb des vorliegenden Unterrichtsvorhabens können exemplarische Bezüge folgendermaßen hergestellt werden:
- Bezüge zum Medienkompetenzrahmen NRW:
- Informieren und Recherchieren (2.1, 2.2, 2.3)
In der Quellenarbeit (z. B. Arolsen Archives) und der Vorbereitung digitaler Präsentationen wird gezielt nach thematisch relevanten, glaubwürdigen Informationen recherchiert, diese ausgewertet und kritisch bewertet. - Produzieren und Präsentieren (4.1, 4.2, 4.3)
Die Schülerinnen und Schüler gestalten adressatengerechte Medienprodukte (z. B. Zweitzeugenberichte als Podcast, Website, Video) und dokumentieren ihre Quellen sachgerecht. - Analysieren und Reflektieren (5.1, 5.2)
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Wirkung und Aussagekraft verschiedener medialer Zugänge (z. B. VR, Audio, Text) zur Darstellung historischer Ereignisse und reflektieren, wie diese zur Meinungsbildung beitragen.
- Informieren und Recherchieren (2.1, 2.2, 2.3)
- Beitrag zur Demokratiebildung (Quelle: Webauftritt „Demokratie in Schule NRW“):
- Quellenanalyse und kritisches Denken: Schülerinnen und Schüler lernen, historische Quellen und Darstellungen kritisch zu analysieren. Dies fördert die Fähigkeit, Informationen zu bewerten, zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden und sich ein fundiertes Urteil zu bilden. Diese Kompetenz ist entscheidend für das Verstehen aktueller politischer Debatten und das Engagement in einer demokratischen Gesellschaft.
- Medienkompetenz: Die Fähigkeit, historische Ereignisse in Medien, Filmen, Zeitungen und Online-Darstellungen zu hinterfragen und kritisch zu reflektieren, fördert die Demokratiebildung, da sie die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Manipulation und Propaganda zu erkennen und sich kritisch mit der medialen Vermittlung von Geschichte auseinanderzusetzen. Mögliche Umsetzung: Filmseminare zu NS-Filmen.
- Auseinandersetzung mit Minderheiten und Verfolgung: Die Reflexion über die Verfolgung von Minderheiten in der Geschichte, wie beispielsweise im Nationalsozialismus oder in anderen autoritären Systemen, fördert das Verständnis für die Bedeutung von Schutzrechten für Minderheiten in einer Demokratie. Schülerinnen und Schüler lernen, wie wichtig es ist, demokratische Prinzipien wie Gleichheit, Toleranz und Menschenrechte zu verteidigen.