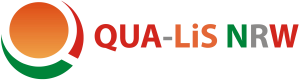Ergänzende Erläuterungen zum Aufbau des Kurses
Überlegungen zum Kurs
Dieser Kurs ist eine digitale Adaption des linearen Unterrichtsvorhabens „Spielend lernen – Spiele mit konditionellen, koordinativen und kognitiven Anforderungen spielen,variieren und eigenständig weiterentwickeln", welches über den Lehrplannavigator
zu finden ist.
Der Kurs knüpft an das zweite Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufe 5 im schulinternen Beispiellehrplan an und ist so konzipiert, dass zunächst eine Aktivierung des Vorwissens stattfindet. Dies soll in der Praxis über zwei exekutiv-funktional anspruchsvolle
Spiele geschehen, um anhand dieser die Merkmale solcher Spiele in Erinnerung zu rufen. Um das benötigte theoretische Hintergrundwissen zu sichern, werden innerhalb des Kurses kleine Wissenabfragen eingebaut, welche an verschiedenen Stellen des Kurses
zu finden sind.
Die Unterteilung in zwei weitere Arbeitsbereiche ergibt sich aus der Fokussierung des urspünglichen, klassischen Unterrichtsvorhaben und den Überlegungen zu einem möglicherweise in der Sekundarstufe II anknüpfenden Unterrichtsvorhaben. In dem hier erstellten Kurs sollen die Inhibition und die kognitive Flexibilität den Schwerpunkt darstellen, da diese für die Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe 7 besser erfahrbar und greifbar sind als das Updating. Diese exekutive Funktion bedarf womöglich der intensiveren theoretischen Auseinandersetzung, weshalb sie sich als Unterrichtsgegenstand für die Sekundarstufe II anbietet.
Innerhalb der Arbeitsbereiche "Inhibition" und "Kognitive Flexibilität" sollen die beiden exekutiven-Funktionen den Lernenden in der Praxis erfahrbar gemacht werden und mit weiterem Theorieinput vertieft werden. Außerdem dienen beide exekutiven Funktionen als Zielsetzung der Spielvariation und Spieler(weiter)entwicklung. Die Schülerinnen und Schüler sollen in Gruppen zwei ausgewählte Grundspiele kriterienorientiert exekutiv-funktional variieren und somit ein lernförderliches Spiel entwickeln. Kriterien für eine gelungene Weiterentwicklung können z.B. sein, dass das Spiel
- Spaß macht,
- herausfordernd ist,
- es einen klaren Sieger gibt,
- die Regeln einfach zu verstehen sind,
- alle Mitschüler und Mitschülerinnen in Bewegung sind,
- die Zielsetzung der exekutiv-funktionalen Anpassung erfüllt.
Diese Kriterien sind als erste Orientierung gedacht und können von den Kollegen und Kolleginnen dem Kursverlauf entsprechend angepasst werden. Der Variationsprozess [1] findet kleinschrittig (siehe einzelne Arbeitsbereiche "Inhibition"/"Kognitive Flexibilität"), von der Lehrkraft unterstützt und mithilfe von Tippkarten (siehe Lernmaterial) statt und soll das kriterienorientierte Entwickeln und Spielen von lernförderlichen Spielen und Spielformen fördern und schulen. Zur Differenzierung finden Sie und die Lernenden die Tippkarten in zwei unterschiedlichen Komplexitätsstufen vor. Am Ende der Arbeitsphasen reflektieren und beurteilen die Lernenden die variierten, präsentierten und durchgeführten kleinen Spiele mithilfe eines Feedbackbogens. Dabei sollen die entwickelten Spiele dahingehend beurteilt werden, ob z.B. die Zielsetzung eines inhibtionsfördernden Spiels erreicht wurde. Die Lehrkraft kann eine punktuelle Leistungsbewertung [2] mithilfe des Bewertungsbogens (siehe Lehrermaterial) vornehmen.
Im klassisch angelegten Unterrichtsvorhaben würde innerhalb der fortschreitenden Sequenzen eine Reduktion der Unterstützung durch die Lehrkraft erfolgen (Link: UV klassisch). Im Rahmen dieses Kurses können Sie als Kolleginnen und Kollegen flexibel entscheiden,
wie stark Sie in den verschiedenen Arbeitsbereichen unterstützend tätig sind oder ob sie womöglich mit weiterem digitalen Lernmaterial den Arbeitsprozess weiter entlasten und die Lernenden selbstständig arbeiten lassen wollen.
Um Ihnen die Planung der unterrichtlichen Praxis zu erleichtern, wurden für das klassische UV exemplarische Stundenverlaufspläne zu einzelnen Unterrichtsstunden erstellt, welche Sie im Lehrplannavigator finden können (Link zum lehrplannavigator). Auf dieser Plattform führen die einzelnen Arbeitsschritte in den Arbeitsbereichen zu den Erarbeitungsphasen im Unterricht. Für den Kurs findet eine beispielhafte Auswahl von Übungsformen und Grundspielen statt (Zehnerball und Hühnerball). Diese Spiele wurden gewählt, da sie auch in einem halbierten Hallendrittel gespielt werden können (7:7 und 7:7) Da die ausgewählten Spiele lediglich der Orientierung dienen, können auch den Schülerinnen und Schülern bekannte Spiele als Ausgangspunkt gewählt werden. Speziell eignen sich dazu bekannte Aufwärmspiele im Sinne von Lauf-, Staffel-, Abwurf- oder Fangspielen, bei denen Handlungs-, Material-, Raum-, Zeit- oder Personenregeln (Diegel, 1980) kognitiv-anspruchsvoll gestaltet werden. Auch wenn die einzelnen Komponenten der exekutiven Funktionen nur schwer voneinander abzugrenzen sind (vgl. oben), sollte bei den einzelnen Regelveränderungen darauf geachtet werden, dass die angestrebte Schwerpunktsetzung erfolgt, welche später auch die Bewertungsgrundlage darstellt.
Obgleich dieser Kurs durch seinen Inhalt eine womöglich größere kognitive Orientierung beinhaltet, wurde bei der Entwicklung des Unterrichtsvorhabens darauf geachtet, dass das Bewegungsfeld/der Sportbereich 2 „Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen“ erfüllt wird und die didaktische, kindgemäße Reduktion im Sinne der Schülerinnen und Schüler erfolgt. Die Auswahl der Spiele sowie die Gestaltung der Spielsituationen sollte in jedem Fall an der Lerngruppe orientiert sein.
[1] In der UV-Karte des Beispiellehrplans findet sich die Formulierung „variieren und eigenständig weiterentwickeln“. Entwickeln soll in diesem UV als schrittweises Weiterführen und Ausbauen der gewählten Grundspiele verstanden werden. Um die Spiele weiterzuentwickeln, sind Variationen der Spiele notwendig, die anschließend geprüft und verworfen oder beibehalten werden sollen, um zu einer Weiterentwicklung zu gelangen.
[2]
Wie bereits deutlich wurde, entstehen bei der punktuellen Leistungsbewertung Herausforderungen, die auf die Struktur der lernförderlichen Spiele zurückzuführen sind. Da die exekutiv-funktionalen lernförderlichen Spiele so konzipiert werden,
dass sie herausfordernd sind und ein “Scheitern” impliziert ist, wäre es z.B. nicht zielführend, ein gelungenes oder nicht gelungenes „Spielen“ zu beurteilen. Auch die kognitiven Prozesse während der sportlichen Handlungssituationen sind aus
der Außenperspektive nicht eindeutig nachzuvollziehen, weshalb eine Bewertung derselbigen nicht möglich erscheint. Um dennoch eine punktuelle Leistungsüberprüfung zu ermöglichen, wird das Endprodukt, also die durch Variation entwickelten lernförderlichen
Spiele und deren Präsentation als Bewertungsgrundlage verwendet. Diese basiert auf den in der Variationsphase erarbeiteten Kriterien für ein gelungenes Spiel. Hierdurch ist eine Theorie-Praxis-Verknüpfung sichergestellt, die gleichzeitig
überprüft, ob die vermittelten Begrifflichkeiten und Inhalte bezüglich der kognitiven Flexibilität verstanden wurden und von den Schülerinnen und Schülern auf die Praxis übertragen werden können. Aus den genannten Gründen ist im Rahmen
dieses Kurses die unterrichtsbegleitende Leistungsbewertung von besonderer Bedeutung (siehe UV-Karte im Lehrermaterial).